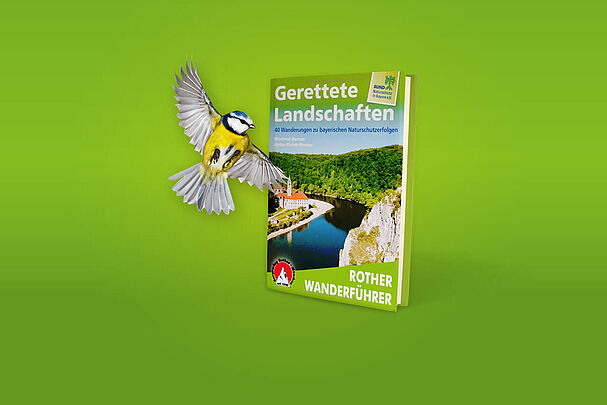Donauried: gerettet vor Magnetschwebebahn und Atomkraftwerk
Das Donauried ist der am dünnsten besiedelte Landstrich Bayerns: Ein 25 Kilometer langer, fast unbebauter Streifen am südlichen Donauufer zwischen Donauwörth und Dillingen. Kein Wunder, dass er zu einem Anziehungspunkt für alle möglichen Ideen und Projekte wurde. Doch man hatte den BUND Naturschutz (BN) und die "Schutzgemeinschaft Donauried" unterschätzt.

In den sechziger Jahren wollte man das Donauried als Bombenabwurfplatz nutzen. Der moorige Untergrund hätte sicher spektakuläre Einschläge ermöglicht – und die Abwürfe zugleich weggesteckt, ohne alsbald wie eine Mondlandschaft auszusehen.
Verhindern einer Magnetschwebebahn
Um 1972 herum die nächste großartige Idee: Eine Teststrecke für die Magnetschwebebahn (später: Transrapid) sollte im Donauried gebaut werden, um die Praxistauglichkeit dieser neuen Technik unter Beweis zu stellen. Von Gundremmingen nach Pfaffenhofen, über eine Länge von 50 Kilometern, sollten Betonstelzen für eine Trasse in die Landschaft gebaut werden, auf der die Züge auf einem starken Magnetfeld reibungsfrei dahingleiten sollten – aber bei Geschwindigkeiten bis 500 km/h alles andere als geräuschlos.
Dass es für diese Lösung kein passendes Problem gab, das den Bau einer solchen Bahn gerechtfertigt hätte, nämlich schlicht keinen Transportbedarf, störte die Planer nicht: Sie hatten von vornherein nichts anderes im Sinn als beheizte Luft von A nach B zu transportieren – sowie von Zeit zu Zeit Politiker, Journalisten und potenzielle Kunden. Die flache Landschaft des Donaurieds war dabei nur das "Bühnenbild" zwischen A und B.
Doch die Planer hatten nicht mit der Heimatliebe der Einheimischen gerechnet: Sie waren nicht gewillt, ihre Landschaft zu einem Verkaufsgelände für eine Technologie machen zu lassen, die sie nichts anging. Heimatbewusste Bauern, der engagierte Tierarzt Dr. Jochen Meyen und die damals noch kleine BN-Kreisgruppe Dillingen leisteten Widerstand und gründeten eine der frühesten Bürgerinitiativen in Bayern, die "Schutzgemeinschaft Donauried". 1977 gab die Regierung das Vorhaben auf.
Widerstand gegen Atomkraftwerk
Die Donaurieder hatten indes wenig Zeit, sich über ihren Erfolg zu freuen. Schon im Jahr darauf beglückte die Politik sie mit der nächsten großartigen Idee: Ein Atomkraftwerk sollten sie bekommen, zwei Kilometer von Pfaffenhofen an der Zusam entfernt. Der BN und die Schutzgemeinschaft standen vor der nächsten Bewährungsprobe.
Zu Tierarzt und Bauern gesellten sich der Landarzt Dr. Kurt Michl und der Lehrer Gernot Hartwig. Sie mobilisierten die Bevölkerung, organisierten Protestkampagnen und gründeten eine Ortsgruppe des Bund Naturschutz. Nach langem Kampf bestanden die Donaurieder schließlich auch diese Prüfung. 1984 wurden die Planungen auf Eis gelegt und 1996 endgültig aufgegeben – ein Jahrzehnt nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl.
Jahrelang waren davor im Sommer Bittprozessionen über die Felder gezogen, mit hunderten von Teilnehmern, voran getragenem Kruzifix und wehenden Fahnen, mit Musikkapellen, Schützen- und Trachtenvereinen – nur dass der Pfarrer nicht bloß um eine gute Ernte flehte, sondern um Verschonung "vor diesen furchtbaren Kühltürmen und all den Folgen eines solchen Kernkraftwerkes". In Buttenwiesen drohten die Bürger sogar das Rathaus zu stürmen und öffentlich ihre Parteibücher zu verbrennen. Ein Schild vor dem Kirchenportal warnte: "Wer verkauft, verrät die Heimat".
Das Misstrauen gegen "brillante Ideen" von oben ist geblieben. Am geplanten Standort der Kühltürme des Atomkraftwerks zwei Kilometer nördlich von Pfaffenhofen mahnt das zwölf Meter hohe "Atomkreuz", und in das "Magnetschwebebahnkreuz" zwei Kilometer westlich ist ein Spruch des Heimatdichters Alois Sailer eingemeißelt: "Herr, schenk Du Fried dem Donauried / und schütz' dies Land vor Unverstand!"
Doch nicht allein auf Gottvertrauen setzen die Donaurieder: Die Ortsgruppe des „Bund Naturschutz" besteht weiter – unter der Leitung des mittlerweile pensionierten Schullehrers und weiterhin aktiven Naturschützers Gernot Hartwig.