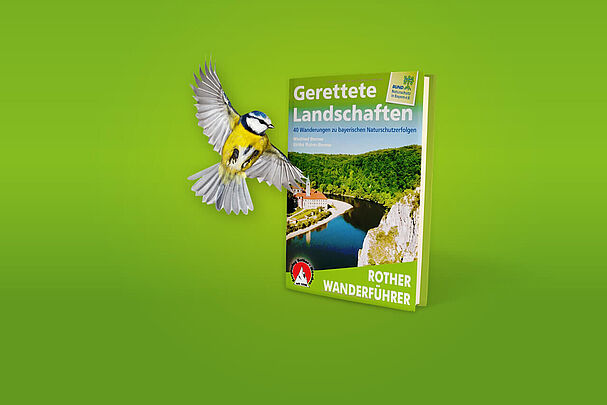Olympia in Oberbayern? NOlympia!
Bürgerinnen und Bürger haben mit NOlympia eine gigantische Naturzerstörung in Oberbayern verhindert: Artenreiche Talwiesen und Schutzwald sollten verschwinden, stattdessen hätten Parkplätze, Medienzentren, Olympiadorf, Speicherseen und nicht zuletzt künstliche Pisten, Stadien und Bahnen die Landschaft dominiert.
"Sehr geehrte Fahrgäste, wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit", schallte es den Passagieren der Münchner S-Bahn im Spätherbst 2013 entgegen: "Die S-Bahn München unterstützt die Bewerbung um die Olympischen Spiele 2022. Der hierfür nötige Infrastrukturausbau sichert die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs. (…) Wir bitten daher um Ihre Unterstützung beim Bürgerentscheid am 10. November."
Mit allen Mitteln versuchten der Olympische Sportbund und die Politik, die (ober)bayerische Bewerbung für die Winterspiele 2022 durchzudrücken. Nachdem der Anlauf für 2018 kläglich gescheitert war, rechnete man sich für 2022 umso bessere Chancen aus. Doch dafür mussten die "Olympier" alle vier Bürgerentscheide gewinnen, die das Bündnis NOlympia unter engagierter Mitwirkung des BN in München sowie den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen, Traunstein und Berchtesgadener Land durchgesetzt hatte. Um die Wähler zu beeinflussen, schreckten die Kommunen nicht einmal davor zurück, ihnen zusammen mit den Abstimmunterlagen Werbematerial pro Olympia zuzuschicken.
Rücksichtslos gegenüber Natur und Gemeinden
Die gleiche Bedenkenlosigkeit hätten die Olympier wohl auch gegenüber der strapazierten Natur des Alpenrands an den Tag gelegt, allen Bekenntnissen zu "nachhaltigen Spielen" zum Trotz. Auch wenn zum Teil vorhandene Anlagen verwendet werden sollten, hätten sie olympiatauglich "aufgebohrt" werden müssen.
Die Athleten und ihre Ansprüche sind dabei gar nicht das Problem; weit dramatischer ist der Flächenbedarf für Zuschauer, Autos, Funktionäre und Medien. Da das IOC vor allem an den Fernsehrechten verdient, hat sich alles den Fernsehbildern unterzuordnen. Auf Biotope und andere lokale Empfindlichkeiten kann da keine Rücksicht genommen werden. So sollten im Münchner Olympiapark allein für das Olympische Dorf 2630 Bäume fallen.
Ein weiteres Problem ist der Schnee. Wer im Spätwinter auf 650 bis 750 Metern Meereshöhe Langlaufwettbewerbe durchführen will, kann sich nicht auf die Natur verlassen. Er braucht Schneekanonen, Starkstrom – und muss vor allem alles verfügbare Wasser der Umgebung in Speicherteichen auffangen, denn ohne Wasser nützen die teuersten Schneekanonen nichts. Außerdem braucht er einen Untergrund, auf dem die künstliche Pracht nicht sofort wieder wegschmilzt: 9 bis 12 Meter breite, mit Asphaltsplitt befestigte Loipen, die bei Schwaiganger in zwei neu zu errichtenden Langlauf- und Biathlon-Stadien starten und enden sollten.
Diese Stadien wie auch die Loipenstraßen sollten, so versicherten die Olympier treuherzig, nur für die Dauer der Spiele bestehen; danach sollte die Natur in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden, mancherorts sogar in einen besseren Zustand als zuvor.
Welch eine Anmaßung! Eine Landschaft, die die Natur in Jahrmillionen geschaffen hat, mal schnell für ein 17-Tage-Event umzupflügen, um dann mit Baggern und Raupen "den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen" oder gar einen besseren, das ist entweder unglaublich naiv oder eine vorsätzliche Täuschung, in keinem Fall aber ist es ein einlösbares Versprechen.
Vertragslasten höchst unfair verteilt
Ein zusätzlicher Skandal war der sogenannte Host-City-Vertrag (HCV), den die beteiligten Kommunen hätten unterschreiben müssen. Er sorgt dafür, dass der größte Gewinner der olympischen Spiele schon lange vor deren Beginn feststeht: das IOC.
Ein Rechtsgutachten des Regensburger Professors Dr. Gerrit Manssen stellte trocken fest: "Der HCV ist ein Knebelvertrag. Das IOC nutzt seine unkontrollierte Monopolstellung für teilweise rechtlich groteske, den Vertragspartner einseitig belastende Regelungen, die jedem Anstands- und Gerechtigkeitsgefühl widersprechen. Der Vertrag lastet nahezu alle Risiken der Stadt an und gibt fast alle Rechte an das IOC."
Am Abend des 10. November endete der Alptraum mit einem vierfachen Sieg der Olympiagegner: Zwischen 51,6 und 59,7 Prozent der Bürger bescherten den geschäftstüchtigen Träumen eine Abfuhr. Einmal mehr hatte David mit Witz und Präzision Goliath besiegt. "Too much democracy", maulte ein Eishockey-Trainer hinterher. Nein, gerade genug, um heute noch durch das oberbayerische Alpenvorland wandern zu können – nicht, um Abschied zu nehmen, sondern um uns an seiner Rettung zu erfreuen.
Schon die Bewerbung für 2018 war gescheitert
Vier Jahre zuvor hatten sich München und sein skitauglicher "Vorort" Garmisch-Partenkirchen mit ihrer Bewerbung um die Winterolympiade 2018 eine Abfuhr geholt. Dabei ließen sich die BN-Kreisgruppen München und Garmisch-Partenkirchen zunächst trotz erheblicher Skepsis auf die Einladung des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) ein, an der Konzipierung "nachhaltiger Spiele" mitzuwirken. Denn Sport und Olympia haben auch bei Naturschützern viele Sympathien – und außerdem wollen sie (fast) niemandem den Spaß verderben.
Doch je länger die "Einbindung" währte, desto klarer wurde den Naturschützern, dass ihnen nur die Rolle eines Feigenblatts zugedacht war. Sie durften zwar ihre Forderungen und Argumente einbringen, doch genauso gut hätten sie es auch lassen können: Auf die Planungen hatte es keinen erkennbaren Einfluss. Wo immer sie auf Probleme aufmerksam machten oder einen Klärungsbedarf anmeldeten, der DOSB erklärte öffentlich, in enger Zusammenarbeit mit dem Naturschutz seien alle Fragen geklärt, strittige Punkte gebe es nicht.
Zugleich wurde klar, dass die angeblich so nachhaltigen Spiele ein gigantischer Raubbau an der ohnehin geschundenen Natur des Werdenfelser Landes sein würden: Schwere, teils irreparable Schäden für ein zweiwöchiges Spektakel. So sollte in Oberammergau ein Langlauf- sowie ein Biathlonstadion mitten in wertvolle Landschaften gebaut werden. Dagegen beantragten 400 Bürger ein Bürgerbegehren. Doch der DOSB fürchtete offenbar das Ergebnis: Noch vor seiner Durchführung wurde Oberammergau als Austragungsort gestrichen.
NOlympia rettet die Landschaft um Garmisch-Partenkirchen
In Garmisch-Partenkirchen wären wesentliche Teile der artenreichen Talwiesen zwischen der Stadt und dem Ortsteil Hammersbach unter dem Olympischen Dorf sowie einem gigantischen Medienzentrum verschwunden. Hektarweise sollte der Schutzwald gerodet werden, um Skipisten "fernsehgerecht" auszubauen und riesige Wasserbecken für die Schneekanonen anzulegen.
Trotz aller Widerstände behauptete der damalige DOSB-Vorsitzende Michael Vesper immer wieder: "Der Zug ist abgefahren." Was er jedoch offenbar nicht wusste, war, dass die Gleise noch nicht verlegt waren. Schließlich stiegen der BUND Naturschutz und die Gesellschaft für ökologische Forschung aus der wirkungslosen Mitwirkung aus und initiierten auch in Garmisch-Partenkirchen ein Bürgerbegehren.
Auch die Bauern und Grundbesitzer reagierten mit wachsender Verärgerung, weil die "Olympier" immer wieder Einigungen verkündeten, von denen die Betroffenen nichts wussten. Die Stimmung kippte: Immer mehr Grundstückseigentümer hatten das Gefühl, verschaukelt zu werden. Schließlich schlossen sich 150 von ihnen zusammen und erklärten öffentlich, dass sie ihren Grund nicht zur Verfügung stellen würden.
Damit hatte das Hase-und-Igel-Spiel der Planer ein Ende, die, um den Widerstand auszubremsen, immer wieder neue Varianten aus dem Hut gezaubert hatten, mit denen angeblich alle einverstanden waren. Auch wenn das Bürgerbegehren knapp scheiterte, hatte das IOC offenbar begriffen, dass die Stimmung unbegeistert war, und vergab die Winterspiele 2018 nach Korea.