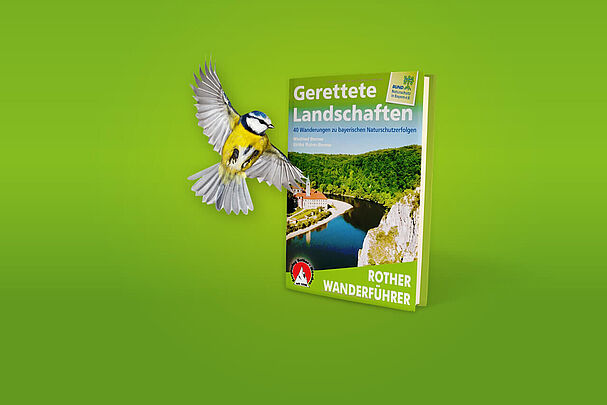Großer Pfahl: Vor der "Total-Verschotterung" bewahrt
Vom Großen Pfahl, heute die Attraktion von Viechtach, wäre nicht mehr viel übrig, wenn Naturschützer nicht seit den dreißiger und bis in die fünfziger Jahre immer wieder interveniert hätten. Das harte Quarzgestein war begehrter Schotter für den Straßenbau – und in der strukturschwachen Region war man um jeden Arbeitsplatz froh. Schon 1939 wurde der Große Pfahl unter Naturschutz gestellt – allerdings nur die spektakuläre "Außenfassade" und ihr Umgriff, erst 1993 war endgültig Schluss.

Der Pfahl ist eine Quarzformation, die sich wie ein Drachenkamm südlich der Regentalsenke quer durch den Bayerischen Wald zieht. Er beginnt östlich von Schwandorf und reicht bis Aigen im Mühlviertel, ist aber nicht auf seiner ganzen Strecke sichtbar. Die markantesten Formationen sind zum einen die Burgruine Weißenstein südlich der Stadt Regen, die direkt auf dem Pfahl thront, zum anderen die weiß schimmernden Felsformationen westlich von Viechtach, die wegen ihres markanten Erscheinungsbilds "Großer Pfahl" genannt werden. Doch auch Schloss Thierlstein bei Cham und das Freyunger Schloss Wolfstein stehen auf dem Pfahl.
Die bizarren Felsformationen des Pfahls kommen zustande, weil sich längs durch den Bayerischen Wald eine geologische Störungszone zieht, in der zu erdgeschichtlichen Zeiten kieselsäurehaltiges Gestein aufstieg: Geologen sprechen von einem "Härtlingszug". Das Quarz des Pfahls ist härter als die umgebenden Gesteine und hält daher der Verwitterung besser stand. Deshalb ragen die Quarzfelsen an manchen Stellen wie senkrechte Wände bis zu 30 Meter hoch auf.
Doch die "geologische Eigentümlichkeit des Bayerischen Waldes", wie die "Blätter für Naturschutz" den Pfahl 1930 nannten, fand nicht nur Bewunderung bei Landschafts- und Naturfreunden – schon lange davor hatte sie auch ganz andere Interessenten angelockt. Bereits seit dem 19. Jahrhundert fand dort Quarzabbau statt, weil der gewonnene Schotter sich hervorragend für den Unterbau von Straßen eignete.
Flehen um einen Kompromiss
Historisch interessant ist, dass noch Anfang der 1930er Jahre in der damaligen Verbandszeitschrift "Blätter für Naturschutz" vom Grundsatz her Verständnis für den Quarzabbau geäußert wurde. In Heft I 1930 schrieb Klement Träsch aus Bernried:
"In volkswirtschaftlichem Interesse lässt es sich nicht umgehen, den Quarz des Pfahles, der aus chemisch reiner Kieselsäure besteht, industriell auszuwerten. Solange man sich bei dem Abbau des Pfahlgesteines auf weniger charakteristische Felspartien beschränkt, wird sich wohl auch vom Standpunkt des Naturschutzes aus nichts einwenden lassen. Betrüblich ist es aber, wenn mit dem Abbau dieses Naturwunders selbst vor den schönsten und ausgeprägtesten Formen nicht Halt gemacht wird.
Bisher wurde das unmittelbar in nordwestlicher Fortsetzung von dieser höchsten Erhebung gelegene Felsmassiv abgebaut und in einem Schotterwerk zu Straßenschotter verarbeitet. Da das Schotterwerk tiefer liegt als die Abbaufläche, so kann auch das in der Erde ruhende Gestein ohne erhebliche Mehrkosten abgebaut und zum Pochwerk gefördert werden. Rohmaterial wäre da sicher noch auf lange Zeit vorhanden. Eine im verflossenen Jahre in verschiedenen Tageszeitungen enthaltene Nachricht über vorgenommene Sprengungen an der höchsten Partie des Pfahles musste daher mit Bedauern aufgenommen werden. Es wäre nicht notwendig gewesen, diese schöne Partie jetzt schon zu zerstören. Der Betrieb hätte ohne diesen Eingriff (…) wohl noch lange ohne Schädigung weitergeführt werden können.
Etwas weiter nordwestlich von der jetzigen Abbaustelle befinden sich noch einige sehr schöne, malerische Felsgruppen. Doch reichen sie, was Größe anbelangt, bei weitem nicht an das nun der Zerstörung anheimgefallene Felsmassiv heran. Es wäre sehr erfreulich, wenn es gelänge, wenigstens diese Felspartien unter den Naturschutz zu bringen. Würden auch diese der Vernichtung anheimfallen, so würde Viechtach viel von der landschaftlichen Schönheit seiner Umgebung und von seiner Anziehungskraft auf den Fremden wohl so ziemlich alles einbüßen."


Erwartungsgemäß machten diese Klagen und behutsam vorgetragenen Appelle wenig Eindruck auf die Steinbruch-Unternehmer. Und so folgt in Heft II 1931, die nächste Schreckensmeldung – doch auch sie eher von Trauer und Verständnislosigkeit geprägt als vom Willen zur Gegenwehr:
"Am großen Pfahl bei Viechtachwurden in letzter Zeit, wie berichtet wird, ganz in der Nähe der höchsten Erhebung von einem mächtigen Block etwa 25 - 30 Kubikmeter abgesprengt. Ringsumher ist eine Trümmerstätte. Es war keine Notwendigkeit für das bestehende Schotterwerk gegeben, diese schönen Pfahlpartien jetzt schon anzugreifen, denn das Werk konnte auch ohne diesen Eingriff weiterarbeiten. Ein Naturdenkmal, das in seiner geologischen und auch botanischen Bedeutung (Vorkommen des Leuchtmooses) tausendmal wichtiger und wertvoller für Wissenschaft und Allgemeinheit ist als irgendein historisches Türmchen oder Erkerchen, geht seiner Vernichtung entgegen."
Das Bezirksamt interveniert
Drei Jahre später, nach erneuten Sprengungen, so berichtet die "Blätter" (Heft II 1936), gelang es den Naturschützern offenbar, das Bezirksamt Viechtach zu einer Intervention zu bewegen – und zwar in einer Sprache, die das Schotterwerk verstand:
"Kurz vor Ostern 1936 wurden an einer der schönsten Stellen am Pfahl bei Viechtach unerlaubte Felssprengungen vorgenommen. Hierauf machte das Bezirksamt Viechtach das Quarzschotterwerk darauf aufmerksam, dass der Pfahl ein Naturdenkmal im Sinne des § 3 des Reichsnaturschutzgesetzes ist und nicht zerstört oder verändert werden darf. 'Gemäß § 17 Abs. 2 desselben Gesetzes werden zur einstweiligen Sicherstellung des Pfahls vor weiteren Zerstörungen auch die auf Ihrem Grundstück Plan Nr. 1193½a gelegenen Partien des hohen Pfahls in Schutz genommen. Es wird somit verboten, an diesem Teil des Pfahls ohne Genehmigung des Bezirksamts Veränderungen irgendwelcher Art, insbesondere Sprengungen, Bohrungen, Anschläge usw. vorzunehmen. Zuwiderhandlungen werden nach § 21ff. des R.N.Sch.G. verfolgt.'"

Wie schon seit 1930 gefordert, wurde der Große Pfahl am 21. März 1939 offiziell unter Naturschutz gestellt – allerdings nur die steil aufragenden Außenwände des Pfahls und ihr Umgriff: Im Inneren durften Spreng-arbeiten und das Brechen des Gesteins in der "Quetsch" weitergeführt werden. Immer wieder, auch noch in der Nachkriegszeit, gab es Bestrebungen, den gesamten Großen Pfahl samt seinen Außenwänden abzuräumen, um alles verwertbare Quarzgestein zu Geld zu machen.
Ohne Erfolg, so vermeldet 1950 mit knappen Worten das einzige in diesem Jahr erschienene Heft der "Blätter für Naturschutz":
"Der Pfahl im Bayerischen Wald konnte erhalten werden. Sein Abbau zur Quarzgewinnung für die dort ansässige Industrie war geplant."
Zwei Jahre später, in Heft 3/4 1952 eine Meldung, die von heftigem Gerangel hinter den Kulissen und einer keinesfalls entschiedenen Auseinandersetzung zeugt:
"Große Schwierigkeiten verursacht immer wieder die Sicherstellung des Pfahls bei Viechtach. Industrielle Betriebe wollen dieses einzigartige Naturdenkmal dem Quarzabbau erschließen. Bisher gelang es dem Bund, dieses Vorhaben zu vereiteln."
Endgültig eingestellt wurden die Steinbrucharbeiten im Großen Pfahl erst 1993. Bis dahin bestand das Kuriosum, dass inmitten des darum herum liegenden Naturschutzgebietes Sprengungen stattfanden und unter ohrenbetäubendem Lärm das Gestein gebrochen wurde. Das NSG wurde also buchstäblich von innen ausgehöhlt. Heute bezeugt eine riesige, langgezogene, tief eingeschnittene Wanne, wie wenig Gnade die Quarzbrecher mit der Natur hatten.
Die Natur erobert den Steinbruch zurück
Als vollen Erfolg für den Naturschutz kann man den Großen Pfahl also sicher nicht bezeichnen. Doch zumindest wurde eine völlige Zerstörung abgewendet, die von den heute noch so eindrucksvollen Quarzformationen nichts übriggelassen hätte. Wie man vor Ort sieht, ist der Unterschied in Natura größer als er auf dem Papier erscheint.
Heute, 30 Jahre nach Ende des Quarzabbaus, bietet sich den Besuchern ein friedliches Bild: Der mörderische Lärm der "Quetsch" ist verstummt, den früher allgegenwärtigen Gesteinsstaub hat der Regen in den Boden gewaschen, und die Natur ist mit sichtlichem Erfolg dabei, sich die bizarre "Riesenbadewanne" zurückzuerobern. Ihre steilen Wände bieten Nistplätze für Felsbrüterinnen, die Tümpel am "Wannenboden" locken Amphibien. Ja, klar: Natur aus zweiter Hand – aber was für eine!
Ein schöner, abwechslungsreicher Rundweg führt um das, was vom Großen Pfahl übriggeblieben ist. Schon oberhalb des Parkplatzes an der B85 locken die wilden Felszinnen – und lassen einem nur noch die Wahl, nach links oder nach rechts zu gehen. Wir empfehlen, den Rundweg entgegen dem Uhrzeigersinn zu gehen, weil man dann gleich zu Beginn des gut einstündigen Rundwegs einen Eindruck von dem ehemaligen Schotterwerk und seinen Folgen bekommt – doch andersherum führt er in fast der gleichen Zeit zum Ziel.
- Ausgangspunkt: Parkplatz nördlich der B85 (ca. 2 km vom Bahnhof Viechtach)
- Länge / Gehzeit: 4,5 km / 1 Stunde (erweiterbar auf 10 km über großen Rundwanderweg Nr. 4)
- Wegcharakter: Großteils befestigte Wege
- Einkehr: Entlang des Weges keine / Viechtach