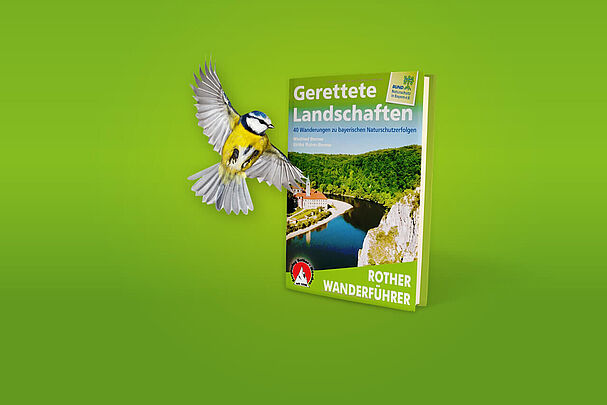Oberes Altmühltal: Gungoldinger Wacholderheide und Arnsberger Leite
Auf der einen Seite steil abfallende Hänge, auf der anderen die wohl größte bayerische "Steppenheide". Mit der Arnsberger Leite und der Gungoldinger Wacholderheide beherbergt das obere Altmühltal zwei landschaftliche Juwelen für deren Schutz sich der BUND Naturschutz (BN) bereits seit den 1930er-Jahren einsetzt.

Er muss eine beeindruckende Persönlichkeit gewesen sein, der Naturwissenschaftler und Theologe Prof. Dr. Franz Xaver Mayr (1887 – 1974). Der promovierte Botaniker war fast ein halbes Jahrhundert lang, von ihrer Gründung im Jahr 1924 bis 1972, Vorsitzender der BN-Kreisgruppe und im Landkreis Eichstätt sozusagen der personifizierte Naturschutz. Er sorgte früh für eine feste Verankerung des Naturschutzes in der Region, trug aber auch eine umfangreiche Fossiliensammlung aus Solnhofener Plattenkalken zusammen, die 1976 zum Grundstock des Juramuseums Eichstätt wurde.
Gungoldinger Wacholderheide
Auf sein Wirken geht es zurück, dass die Gungoldinger Wacholderheide in ihrem Wert erkannt und 1959 unter Schutz gestellt wurde – mit rund 70 Hektar die größte ihrer Art in ganz Bayern. Charakteristisch für diese "Steppenheide" sind die zahlreichen Wacholderbüsche und -säulen, die sich auf den sanften Hängen mit ihrem Trocken- und Halbtrockenrasen verteilen. Dazwischen wilde Rosen und zahlreiche seltene Pflanzen, von der Spitzblättrigen Miere und dem Kahlblättrigen Heideröschen über Orchideen wie den Herbstdrehwurz und das Brandknabenkraut bis zu drei Enzianen: Frühlingsenzian, Gefranster Enzian und Deutscher Enzian.



Die Heide ist keine ursprüngliche Wildnis, sondern eine Kulturlandschaftsform: Sie entstand im Mittelalter durch Rodung des Waldes und extensive Viehbeweidung und ist auf ständige Pflege durch den Menschen bzw. als dessen Subunternehmer durch Schafe und Ziegen angewiesen, weil die Natur sie sonst zurückholen und wieder in Wald verwandeln würde.
Viele seltene Schmetterlingsarten finden auf den Heideflächen gute Lebensbedingungen, ebenso zahlreiche Heuschreckenarten, wie etwa die Rotflügelige Schnarrheuschrecke und die Blauflügelige Ödlandschrecke. Sie müssen allerdings auf der Hut sein vor dem Neuntöter, der dort brütet, und dem unauffälligen Baumpieper, der mehr durch seinen volltönenden, lerchenähnlichen Ruf auffällt als durch sein sperlingähnliches Erscheinungsbild.
Arnsberger Leite
Einen völlig anderen Landschaftscharakter weist die Arnsberger Leite auf, die auf der anderen Talseite etwas flussabwärts liegt – und zwar im Gegensatz zur Gungoldinger Heide am Prallhang, also in der Außenkurve der Altmühl. Steil abfallend sind dort die Hänge, hoch aufragend und beinahe alpin die Felszinnen, in deren Schutz Uhu und Wanderfalke brüten. An einigen Stellen hat die Vorgängerin der Altmühl, die Urdonau, auf der Höhe ihre Spuren hinterlassen: Sogar auf der Höhe finden sich dort völlig unerwartete Kiesablagerungen.
Was Fauna und Flora betrifft braucht sich die Arnsberger Leite nicht vor ihrem berühmteren Gegenstück zu verstecken: Hier gedeihen Pflanzenarten, die man ansonsten eher im Südosten Europas oder südlich der Alpen antrifft, wie das seltene Federgras, der wohlriechende Schneeball, der Edelgamander und der ebenfalls sehr seltene blaue Felsenlattich.



Ein Kuriosum ist, dass die Arnsberger Leite lange Zeit als Naturschutzgebiet galt, aber gar keines war. Den ersten Antrag hatte Prof. Mayr zwar schon 1935 gestellt, doch nur eine Felsenterrasse unter der Gelben Höhle stand seit 1951 unter Schutz. Auf die heutigen 20 Hektar wurde das Schutzgebiet erst 1986 erweitert. Nicht nur Gottes Mühlen mahlen offenbar langsam.
Zur Erinnerung an ihren Gründungsvorsitzenden hat die BN-Kreisgruppe den Steig durch die Arnsberger Leite "Franz-Xaver-Mayr-Weg" benannt.